Das Gebäudeenergiegesetz (Heizungsgesetz) bzw. die überarbeitete Version davon ist seit 2024 in Kraft. Wir werfen hier einen Blick auf alle wichtigen Änderungen und die wichtigsten Inhalte und versuchen diese so einfach wie möglich zu erklären und mit hilfreichen Tipps zu ergänzen.
Was steckt hinter dem Gebäudeenergiegesetz?
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gibt es bereits seit dem 1. November 2020. Es führt das Energieeinspargesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammen und ist ein zentraler Baustein der sogenannten deutschen Wärmewende.
Die Ziele des GEG können folgendermaßen zusammengefasst werden:
- Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden
- Steigerung der Energieeffizienz
- Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung von Gebäuden
- Minderung der Treibhausgas-Emissionen
Das Gebäudeenergie Gesetz (GEG) hat seinen Ursprung im Kyoto-Protokoll von 1997. Dieses internationale Abkommen legte erstmals völkerrechtlich verbindliche Klimaziele fest mit dem Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen in den Industrieländern bis 2020 deutlich zu reduzieren.
Um diese Ziele zu erreichen, hat Deutschland verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht, darunter die Energieeinsparverordnung (EnEV), die am 1. Februar 2002 in Kraft getreten ist. Die EnEV regelte die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude.
2020 wurden die EnEV, das Energieeinspargesetz (EnEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärme Gesetz (EEWärmeG) im Gebäudeenergie Gesetz (GEG) zusammengeführt.
Das GEG verfolgt das übergordnete Ziel, bis 2045 einen klimaneutralen Gebäudebestand in Deutschland zu erreichen.
Anforderung: Was regelt das Gebäudeenergiegesetz (GEG)?
Seit dem 1. November 2020 regelt das GEG die energetischen Anforderungen an Gebäude, insbesondere die Heizungstechnik und den Wärmedämmstandard. Bei einem Kauf von Bestandsgebäuden definiert es konkrete Sanierungspflichten. Für Neubauten gibt es Vorgaben zum Anteil an regenerativen Energien.
Vier Förderrichtlinien unterstützen die Umsetzung:
- BEG WG: Wohngebäude
- BEG NWG: Nichtwohngebäude
- BEG EM: Einzelmaßnahmen
- BEG KFN: Klimafreundlicher Neubau
Seit dem 1. Januar 2024 verschärft die GEG-Novelle den Austausch von Heizungsanlagen, weshalb es oft als „Heizungsgesetz“ bezeichnet wird.
Weitere Informationen findest du hier: https://www.bmwk.de/

Die Vorgaben im Gebäudeenergie Gesetz
Die wichtigsten Vorgaben des GEG konzentrieren sich auf die Heizungstechnik, Wärmedämmung, Klimatechnik und Hitzeschutzmaßnahmen von Gebäuden.
Ziel ist es, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern. Maßgeblich ist der Energiehaushalt eines Gebäudes. Dieser wird anhand von verschiedenen Faktoren bewertet, darunter:
- Raumheizung und -kühlung
- Stromverbrauch (z.B. für die Wärmepumpe)
- Warmwassererzeugung
- Luftaustausch
Zur Berechnung der energetischen Standards kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz, die sich auf unterschiedliche Energieformen beziehen:
- Primärenergie: Umfasst den gesamten Prozess der Energiebereitstellung (z.B. Abbau von Rohstoffen)
- Endenergie: Die Energie, die dem Gebäude von außen zugeführt wird (z.B. Strom, Gas)
- Nutzenergie: Die tatsächlich im Gebäude verwendete Energie (z.B. für Heizung)
Die Ergebnisse der Energiebilanz dienen zur Klassifizierung des Gebäudes nach energetischen Standards.
Die wichtigsten Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes für Neubauten
Seit dem 1. Januar 2023 müssen Neubauten bestimmte energetische Standards erfüllen. Der zulässige Jahres-Primärenergiebedarf ist auf 55 Prozent des Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes reduziert worden. Ab 2024 müssen Neubauten zudem mit mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien beheizt werden. Verschiedene Förderprogramme unterstützen Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude.
Konkrete Bestimmungen für Neubauten im Gebäudeenergie Gesetz 2024
Mit der GEG-Novelle will die Regierung den Einsatz erneuerbarer Energien weiter angekurbeln. Seit dem 1. Januar 2024 sollen in einem Neubau eingebaute neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, vorausgesetzt es handelt sich um ein Grundstück in einem Neubaugebiet.
Dafür kommen verschiedene Technologien in Frage:
- Solarthermische Anlagen
- Biomasseheizungen (zum Beispiel Pelletheizungen)
- elektrische Wärmepumpen
- Brennstoffzellenheizung
- Biomasse
- Wasserstofffähige Heizung
- Innovative Heizungstechnik
- Errichtung, Umbau, Erweiterung Gebäudenetz
- Gebäudenetzanschluss
- Wärmenetzanschluss (Fernwärme)
- Pelletheizung
Wird ein neues Gebäude außerhalb eines Neubaugebiets errichtet, gilt seit Januar 2024 genau wie für neue Heizungen im Bestand: Das Gebäudeenergiegesetz ist an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt.
Die wichtigsten Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes für Bestandsgebäude
Alle Gebäude, die verkauft, vermietet oder neu vermietet werden, benötigen einen Energieausweis, der Auskunft über den energetischen Zustand bzw. Energiebedarf des Gebäudes gibt. Heizungsanlagen in Wohngebäuden mit einer Leistung von mehr als 20 Kilowatt müssen regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden.
Darüber hinaus ist der Einbau einer Ölheizung oder Gasheizung in neuen Wohngebäuden seit 2024 grundsätzlich verboten. Die Anforderungen an die Dämmung von Gebäuden wurden ebenfalls verschärft. Dafrür wird die Installation von Solaranlagen durch verschiedene Förderprogramme unterstützt.
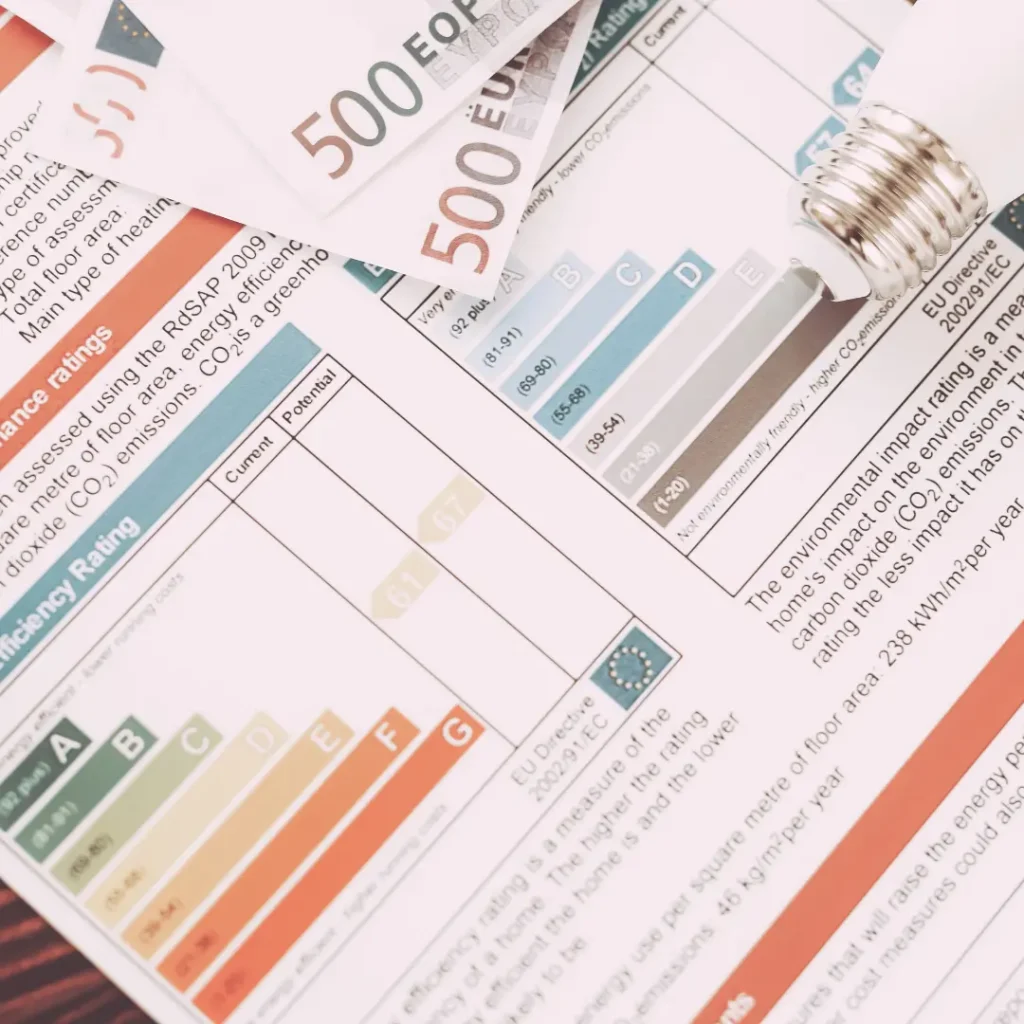
Konkrete Bestimmungen für Bestandsgebäude im Gebäudeenergie Gesetz 2024
Die energetischen Anforderungen an bestehende Gebäude sind im Vergleich zu Neubauten deutlich geringer. Dennoch gibt es auch für Bestandsgebäude diverse Auflagen und Pflichten, die Hausbesitzer kennen und beachten müssen.
Keine Verschlechterung der Energiebilanz
Bei Renovierungen dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden, die die energetische Qualität des Gebäudes verschlechtern. Erweiterungen und Ausbauten müssen hingegen gesetzliche Mindeststandards einhalten, beispielsweise hinsichtlich des Wärmeschutzes der Gebäudehülle oder des energetischen Standards der Heizungsanlage.
Nachrüstpflichten für Altbauten
Unabhängig von einer Sanierung schreibt das GEG für Altbauten diverse Austausch- und Nachrüstpflichten vor. Hausbesitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die ihre Immobilie mindestens seit 1. Februar 2002 selbst bewohnen, sind allerdings von diesen Nachrüstpflichten befreit.
Welche Gebäude betrifft das Gebäudeenergie Gesetz ab Januar 2024?
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gilt grundsätzlich für alle Gebäude, die in Deutschland beheizt oder klimatisiert werden. Dies umfasst sowohl Wohngebäude (Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser) als auch Nichtwohngebäude (Bürogebäude, Gewerbeimmobilien, Schulen, Krankenhäuser etc.).
Es gibt einige Ausnahmen, die nicht den Vorschriften des GEG unterliegen:
- Gebäude mit geringer Nutzfläche: Gebäude mit einer Nutzfläche von weniger als 50 Quadratmetern sind vom GEG ausgenommen.
- Ferienhäuser und Wochenendhäuser: Ferienhäuser und Wochenendhäuser, die weniger als vier Monate im Jahr genutzt werden, fallen ebenfalls nicht unter das GEG.
- Gebäude mit denkmalgeschützter Bausubstanz: Bei denkmalgeschützten Gebäuden können die energetischen Anforderungen des GEG an die historische Bausubstanz angepasst werden.
Was ist der Unterschied zwischen dem Gebäudeenergiegesetz und dem „Habeckschen Heizungsgesetz“?
Das „Habecks Heizungsgesetz“ ist keine eigenständige Regelung, sondern eine mediale Bezeichnung für die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
Die wichtigsten Änderungen durch die Novelle können folgendermaßen zusammengefasst werden:
- Verschärfung der Anforderungen an den Austausch von Heizungsanlagen: Ab 2024 ist der Einbau von Öl- und Gasheizungen in neuen Wohngebäuden grundsätzlich verboten. Für bestehende
Gebäude gilt:
- Ab dem 1. Januar 2024: Bei der Heizungssanierung muss mindestens 65 Prozent der Heizenergie aus erneuerbaren Quellen stammen.
- Ab Mitte 2026: Die Verwendung von Gas- oder Ölheizung in bestehenden Wohngebäuden ist nur noch in Ausnahmefällen möglich.
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bildet den grundlegenden Rahmen für die energetischen Anforderungen an Gebäude in Deutschland. Die Novelle des GEG aus dem Jahr 2024, oft als „Habecks Heizungsgesetz“ bezeichnet, verschärft diese Anforderungen insbesondere im Bereich der Heizungsanlagen. Ziel der Verschärfung ist es, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern, um im Gebäudesektor die Klimaziele zu erreichen.
Tausch bzw. Einbau einer Heizung 2023 / 2024: Welche Heizung ist erlaubt?
Der Heizungstausch bei Bestandsgebäuden bzw. das Thema Heizen war das Aufregerthema Nummer 1 im Jahr 2023. Was wirklich vorgeschrieben ist kannst du folgenden Punkten entnehmen:
- Klimaneutrale Wärmeversorgung für alle: Auch für Bestandsgebäude gilt das Ziel, den Wärmebedarf möglichst zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken. Das bedeutet der allmähliche Umstieg auf erneuerbare Energien.
- Keine Pflicht zur Heizungserneuerung: Die GEG-Novelle schreibt keine sofortige Heizungserneuerung vor. Bestehende Heizungen können weiterbetrieben werden, solange sie funktionsfähig sind.
- Ausnahmen und Übergangsfristen: Bei einem Heizungsausfall gelten mehrjährige Übergangsfristen. Gasheizungen können vorübergehend eingebaut werden, sofern sie auf Wasserstoff umrüstbar sind.
- Entscheidung nach kommunaler Wärmeplanung: Die Umstellung auf klimafreundliche Heizungen ist an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt. Städte und Gemeinden müssen bis 2026 bzw. 2028 konkrete Pläne für eine klimaneutrale Heizungsinfrastruktur vorlegen.
Du hast folgende Optionen für den Heizungstausch:
- Elektrische Wärmepumpe
- Anschluss an ein Wärmenetz
- Hybridheizung
- Heizung auf Basis von Solarthermie
- H2-Ready-Gasheizung
- Biomasse (z.B. Pelletheizung)
- Gasheizung mit mindestens 65% Biomethan, biogenem Flüssiggas oder Wasserstoff
Unser Tipp:
Informiere dich rechtzeitig über die Wärmeplanung in deiner Kommune, um die für dich passende Option zu wählen.
Förderungen laut GEG 2024
Um die Regelungen aus dem GEG umzusetzen, hat die Bundesregierung Förderprogramme auf den Weg gebraucht.
Zu Förderung für energetische Sanierung 2024 gehören folgende Förderprogramme:
Laut Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
In Kraft getreten am 1. Januar 2024
- Grundförderung: 30 Prozent Zuschuss
Einkommensabhängiger Bonus: bis zu 30 Prozent Zuschuss (Einkommen bis 40.000€) - Klimageschwindigkeits-Bonus: bis zu 20% Zuschuss bis 31.12.2028 (ab 2029 degressiv)
- Effizienz-Bonus: 5% für bestimmte Wärmepumpen und Biomasseheizungen
- Maximalförderung: 70% der förderfähigen Kosten (bis zu 30.000€)
Förderfähige Maßnahmen:
- Heizungen mit erneuerbarer Energie (Wärmepumpe, Biomasse, Pellet, Solarthermie, Gasheizung mit grünem Wasserstoff und ähniche).
- Weitere energetische Sanierungsmaßnahmen (z.B. Dämmung).
Die Beantragung erfolgt über einen Online Antrag beim Kundenportal „Meine KfW“. Für Maßnahmen vom 01. Januar bis 31. August 2024 können nachträglich Anträge bis zum 30. November 2024 gestellt werden.
Diese Zusammenfassung soll dir als grober Überblilck dienen. Wir empfehlen ausdrücklich, sich auf den offiziellen Webseiten zu informieren:
Diese Zusammenfassung ist ein Überblick. Bitte informieren Sie sich im Detail auf den offiziellen Websites.
Quelle
Quelle: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2024/02/06-neue-heizungsfoerderung.html
FAQ GEG und Energiebedarf 2024
Im Folgenden findest du einige Fragen, die immer wieder auftauchen, kurz und knapp beantwortet.
Einbau Heizung – Was ist erlaubt?
Auch wenn das GEG die Wärmewende einläuten soll, ist derzeit der Einbau von fossilen und klimaschädlichen Heizungen weiterhin erlaubt. Das gilt nur so lange, bis vor Ort ein kommunaler Wärmeplan vorliegt. In großen Städten ab 100.000 Einwohner:innen wird das bis Mitte 2026 der Fall sein, in kleineren Kommunen bis spätestens Mitte 2028.
Ab 2024 darfst du demnach Öl- und Gasheizungen bis zum Ablauf der Fristen für die kommunale Wärmeplanung (30. Juni 2026 in Kommunen ab 100.000 Einwohner, 30. Juni 2028 in Kommunen bis 100.000 Einwohner) einbauen. Diese Heizungen müssen ab 2029 allerdings dazu geeignet sein, einen wachsenden Anteil an Erneuerbaren Energien wie Biogas oder Wasserstoff nutzen:
- Jahr2029: mindestens 15 Prozent
- Jahr 2035: mindestens 30 Prozent
- Jahr 2040: mindestens 60 Prozent
- Jahr 2045: 100 Prozent
Was geschieht, wenn meine alte Gas- oder Ölheizung defekt ist?
Bestehende Öl- und Gasheizungen knnst du reparieren und können bis 2045 laufen lassen.
Vorsicht: Das gilt nicht für Standard- und Konstanttemperaturkessel. Diese musst du im Rahmen der allgemeinen Sanierungspflicht nach 30 Jahren austauschen, es sei denn du als Besitzer des Ein- oder Zweifamilienhauses bewohnst deine Immobilie seit dem 1. Februar 2002 selbst.
Können die Energie Einsparungen die GEG Kosten ausgleichen?
Die verschärften Regelungen verursachen steigende Kosten für den Betrieb von Heizungsanlagen und deren Einbau. Dafür profitierst du bei einer Heizung mit einem geringeren Energieverbrauch von den geringeren laufenden Ausgaben. Damit entpuppt sich die schärfere Regelung aus dem GEG bezüglich einer Heizung als Investition, die sich durch die niedriegeren Kosten in den zukünftigen Jahren amortisieren kann. Leider kann momentan niemand vorhersagen, welche Entwicklung die Energiepreise in den kommenden Jahren nehmen werden. Somit ist eine verbindliche Aussage zur Renthabilität einer neuen Heizung kaum zu treffen.
Fazit:
Als Hausbesitzer kommt einiges auf dich zu. Nutzt du schon grüne Energie? Nuze gerne den Tarifrechner, um für dich einen passenden Anbieter zu finden:

No responses yet